Das Urteil im Fall des Messeranschlags von Solingen ist gefallen: Issa al Hasan wurde zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt. Der 27-jährige Syrer hatte am 23. August 2024 bei einem Stadtfest in Solingen drei Menschen ermordet und acht weitere teils schwer verletzt. Das Oberlandesgericht Düsseldorf stellte zudem die besondere Schwere der Schuld fest, was eine vorzeitige Entlassung nahezu ausschließt.
Issa al Hasan hatte die Tat als „Heiligen Krieg“ im Namen des IS geplant und während des Angriffs laut Zeugen „Allahu Akbar“ gerufen. Das Gericht wertete seine radikal-islamistische Gesinnung als Grundlage für die Tat und verurteilte ihn neben Mord und versuchtem Mord auch wegen Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Außerdem muss er 360.000 Euro Schmerzensgeld an die Opfer zahlen. Trotz eines attestierten niedrigen IQ bestätigte ein Gutachten seine volle Schuldfähigkeit.
Lebenslange Haft für den Messer-Attentäter von Solingen

Der Angriff auf das „Festival der Vielfalt“ in Solingen schockierte Deutschland tief. Innerhalb von nur einer Minute stach al Hasan mit einem 15 Zentimeter langen Tranchiermesser gezielt von hinten auf die Besucher ein. Drei Menschen starben, darunter eine 56-jährige Frau, die in den Armen ihres Ehemanns verblutete. Weitere acht Menschen wurden schwer verletzt.
Vor Gericht zeigte sich der Täter zeitweise teilnahmslos, wirkte geistig abwesend, äußerte sich nur spärlich. Am Tag des Urteils betrat er jedoch erhobenen Hauptes den Saal und zeigte sogar ein Lächeln angesichts des Medienrummels. Die Tat offenbarte auch ein massives Behördenversagen: Der Täter hätte bereits ein Jahr vor der Tat abgeschoben werden sollen, was jedoch nicht konsequent umgesetzt wurde.
Lassen Sie uns nun einen Blick auf die juristischen Hintergründe und die Bedeutung der besonderen Schwere der Schuld werfen.
Besondere Schwere der Schuld und Sicherungsverwahrung

Das Gericht stellte die besondere Schwere der Schuld fest, eine rechtliche Maßnahme, die eine vorzeitige Entlassung nach 15 Jahren Haft praktisch ausschließt. Diese Feststellung signalisiert, dass das Gericht die Tat als besonders schwerwiegend und verwerflich ansieht.
Zusätzlich ordnete das Oberlandesgericht die Sicherungsverwahrung an. Diese Maßnahme dient dazu, den Täter auch nach der Haftentlassung weiterhin in Haft zu behalten, wenn von ihm eine hohe Gefahr ausgeht. Damit soll die Allgemeinheit vor weiteren Taten geschützt werden.
Im nächsten Abschnitt werden wir die ideologische Radikalisierung des Täters und dessen Motivation näher beleuchten.
Radikalisierung und islamistische Motivation

Issa al Hasan hatte sich seit 2019 massiv islamistisch radikalisiert und verbreitete auf seinem TikTok-Profil Propaganda für den Islamischen Staat (IS). Er hatte die Tat als Racheakt für „unsere Märtyrer“ und für die Toten in Palästina gerechtfertigt, was vom Gericht als unglaubwürdig zurückgewiesen wurde.
Die Richter betonten, dass er die freiheitlich geprägte Lebensweise westlicher Gesellschaften ablehnte und die Ideologie des IS teilte, der weltweit einen gewaltsamen Dschihad fordert. Seine Tat war somit nicht nur ein brutaler Angriff auf unschuldige Menschen, sondern auch Ausdruck einer tief verwurzelten terroristischen Weltanschauung.
Wir wenden uns als nächstes den Folgen für die Opfer und die Stadt Solingen zu.
Auswirkungen auf Opfer und Stadt Solingen

Die Opfer und ihre Familien leiden bis heute unter den Folgen des Anschlags. Witwer Michael W. schilderte vor Gericht eindrucksvoll, wie seine Frau nach der Attacke verblutete und er selbst schwer verletzt wurde. Viele Verletzte kämpfen noch mit den physischen und psychischen Folgen.
Das „Festival der Vielfalt“ sollte ein friedliches Zusammenkommen sein, doch der Anschlag hat die Stadt und das ganze Land nachhaltig verändert. Neben der Trauer über die Opfer hat das Ereignis eine Debatte über Sicherheitsmaßnahmen und das Versagen von Behörden ausgelöst.
Im nächsten Schritt werfen wir einen Blick auf das Behördenversagen und die versäumte Abschiebung.
Behördenversagen und versäumte Abschiebung

Issa al Hasan hätte bereits im Juni 2023 abgeschoben werden sollen, nachdem sein Asylantrag abgelehnt wurde. Ein Abschiebeversuch scheiterte, weil er nicht in seiner Unterkunft angetroffen wurde, weitere Versuche gab es nicht. Dieses Versäumnis wird nun im nordrhein-westfälischen Landtag in einem Untersuchungsausschuss geprüft.
Die Tat zeigt, wie brisant und dringend notwendig eine bessere Koordination zwischen Sicherheitsbehörden und Ausländerbehörden ist, um Gefahren frühzeitig zu erkennen und zu verhindern.
Zum Schluss betrachten wir die juristischen Verfahrensdetails und das öffentliche Echo auf das Urteil.
Prozessverlauf und öffentliches Echo

Der Prozess begann im Mai 2025 vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf. Al Hasan gestand von Beginn an die Tat, zeigte sich jedoch in Teilen geistig abwesend. Das Gericht berücksichtigte ein Gutachten, das ihm einen IQ von 71 bescheinigte, was knapp über der Grenze einer geistigen Behinderung liegt, jedoch die volle Schuldfähigkeit bestätigte.
Das Urteil entspricht der Forderung der Bundesanwaltschaft und der Nebenkläger. Die Verteidigung sprach sich nur gegen die Sicherungsverwahrung aus. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig, doch es setzt ein deutliches Zeichen gegen islamistischen Terror in Deutschland.
Die nächsten Entwicklungen in diesem Fall werden zeigen, wie das Urteil juristisch bestätigt wird und welche Maßnahmen zur Verhinderung ähnlicher Anschläge folgen.
Täter wehrt sich gegen Urteil
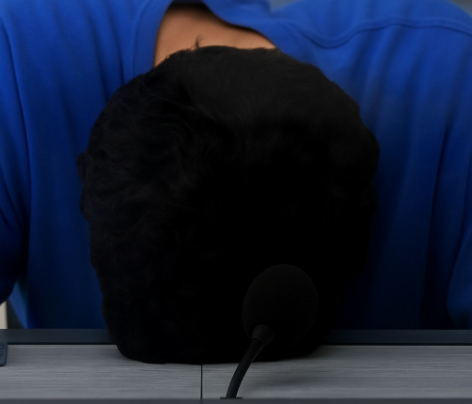
Der wegen des tödlichen Messerangriffs beim Stadtfest in Solingen verurteilte Issa al Hasan (27) hat Revision gegen das Urteil des Oberlandesgerichts Düsseldorf eingelegt. Das teilte das Gericht nur einen Tag nach der Urteilsverkündung mit. Al Hasan war zu lebenslanger Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden. Zudem stellte das Gericht die besondere Schwere der Schuld fest.
Der Attentäter hatte bei der Tat am 23. August 2024 drei Menschen getötet und acht schwer verletzt. Vor Gericht hatte er sich offen zu seinen radikal-islamistischen Motiven bekannt. Jetzt soll der Bundesgerichtshof (BGH) prüfen, ob es im Verfahren Rechtsfehler gab. Die Begründung der Revision steht noch au